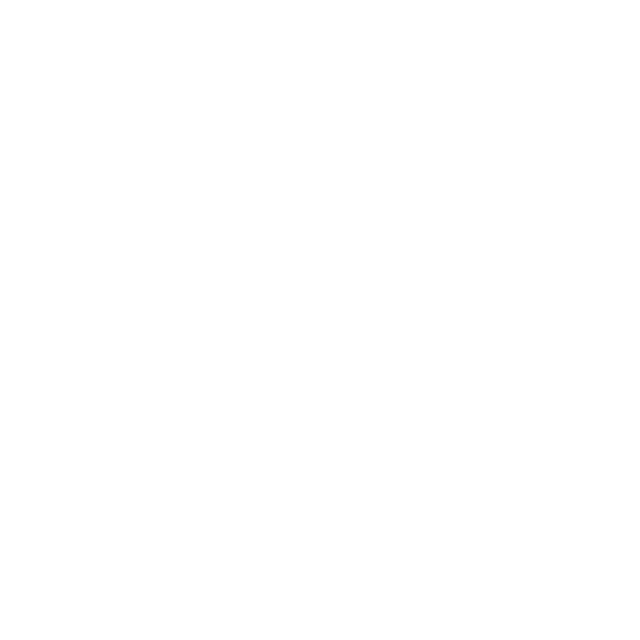Plötzlich redet halb Deutschland über Heimat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte in seiner Festrede zum Tag der Deutschen Einheit: „Verstehen und verstanden werden – das ist Heimat.“ Und: „Heimat ist der Ort, an dem das Wir Bedeutung bekommt.“ Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt konstatierte am vergangenen Wochenende: „Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht.“
Die zum Teil bis in die linksextreme Szene verwachsene grüne Basis widersprach. Die Berliner Abgeordnete Anja Schillhaneck nannte den Begriff Heimat „herkunftsbezogen und zudem tendenziell ausgrenzend“. Auch die Grüne Jugend protestierte: „Heimat ist ein ausgrenzender Begriff. Deshalb taugt er nicht zur Bekämpfung rechter Ideologie.“
Das ist falsch. Heimat ist ein ätherisches, sehr individuelles Gefühl. Man kann sie nicht kaufen, man kann sie nicht geschenkt bekommen. Sie wächst über Monate oder Jahre in einem heran. Jemand, der sagt, er habe keine Heimat, ist nicht ehrlich zu sich selbst.
Denn Heimat hat nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche, noch tiefer gehend sogar eine überzeitliche Ebene (himmlische Heimat). Etymologisch läßt sich der Begriff auf die indogermanische Wurzel ‚kei‘ zurückführen, was so viel heißt wie ‚Ort, an dem man sich niederläßt‘. Zeitbezogen ist Heimat deshalb, weil sie auch und vor allem traditionelle und identitäre Orientierung bietet. Deshalb sprachen Kirchenlieddichter wie Paul Gerhardt auch oft vom Elend und nicht vom Fremden, wenn sie einen Gegenbegriff zu Heimat suchten.
Wie elendig ist ein Leben ohne Sicherheit, ob raum- oder zeitbezogene. Ein gutes, wenn auch trauriges Beispiel bietet meine Heimat Südtirol. 1939 stellten das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland die Südtiroler vor die Wahl: Entweder, sie verlassen ihre Heimat (Optanten) oder sie bleiben in Südtirol, wo sie jedoch Sprache, Brauchtum und Kultur aufgeben müssen (Dableiber).
Für die Tiroler südlich des Brenners bedeutete die erzwungene Entscheidung eine grausame Qual. Zu verwurzelt waren sie mit ihrer Scholle. Zu stolz aber auch auf ihre deutsche Kultur und ihr Brauchtum in einem fremden Staat. Zum Symbol für Heimat erhob sich sowohl für Optanten als auch für Dableiber die blühende Geranie, im Volksmund Brennende Lieb genannt, die fast alle Höfe zierte.
Für die Optanten schrieb Karl Felderer:
So reißet vom sonnigen Erker
Die letzte Brennende Lieb;
Die Treue zu Deutschland war stärker,
Das Heiligste, was uns blieb.Wir nehmen sie mit im Herzen,
Für andere dereinst Symbol;
Sie stille des Heimwehs Schmerzen:
Leb wohl, du mein Südtirol!
In der Version der Dableiber dichtete Hans Egarter:
Am Erker blühet wie immer
Die leuchtende Brennende Lieb
Die Treue zur Heimat war stärker,
Wie jauchzen wir, daß sie uns blieb.O blühe und leuchte, du Blume –
Ein Zeichen der Treue du bist!
Und künde, daß Glaube und Heimat
Das Höchste für uns ist.
Die rührseligen Reime hingen liebevoll eingerahmt in vielen Stuben. Eine Mehrzahl der Südtiroler stimmte schließlich für die Option. Der Zweite Weltkrieg kam dazwischen und durchkreuzte die Umsiedlungspläne der Diktatoren in Rom und Berlin. Doch auch viele Auswanderer versuchten nach 1945 wieder nach Südtirol zurückzukehren, wo sie von den Dableibern oft abschätzig behandelt wurden.
Beide Gruppen wählten die Heimat; die einen die innere, die anderen die äußere. Der Konflikt wird in einer Anekdote meiner Großmutter anschaulicher: Mein Urgroßvater, Bauer auf einem Hof in einem Hochpustertaler Nebental, stimmte zunächst für die Option. Dadurch war es seinen Kindern möglich, auf die deutsche Schule zu gehen.
Den meisten war das damals nicht erlaubt, sahen sich die Südtiroler doch seit Mussolinis Machtergreifung einer fürchterlichen Italianisierungspolitik ausgesetzt. Meine Oma lernte also Deutsch, während ihre Nachbarn in der Schule italienisch sprachen und ihre Muttersprache nur heimlich sprechen durften. Dafür schämte sie sich oft.
Heute muß sie lachen, wenn sie davon erzählt. Denn ihre dem italienischen Lehrer ausgesetzten Mitschüler spotteten und verachteten sie regelrecht wegen ihres Privilegs. Erst viele Jahre später begriff sie, was es denn tatsächlich bedeutet hätte, ihr kleines Heimatdorf in den Alpen für immer zu verlassen. Dasselbe gilt auch für ihre Schulkameraden, deren Eltern sich zum Dableiben entschieden.
An diesem Abend sitze ich hier, fast 900 Kilometer weit weg von Heimathaus und Heimatboden, aber auch weit entfernt von der vertrauten Sprache und den jahrhundertealten Bräuchen. Erst in der Fremde wird klar: Heimat ist unentbehrlich. In der Mathematik gibt es Rechenwege, die zum Ergebnis führen, indem man umgekehrt zählt, etwa die Gegenwahrscheinlichkeit.
Mit der Heimat ist es ähnlich. Man nehme alles weg, was nicht nötig ist, um der eigenen Existenz Identität und Sicherheit zu bieten, und man erhält Heimat. Das kann ein Bergmassiv sein, eine Blume, ein Gedicht, ein Städtchen, der Blick vom seichten Deich aufs weite Meer. Das können liebgewonnene Menschen sein, die gewohnte Kulinarik, die Musik.
Der Versuch, den Begriff Heimat allumfassend zu definieren, scheitert deshalb, weil er so individuell, so subjektiv ist. Seine Heimat zu schützen ist jedermanns Recht und nur natürlich, weil sie eine tiefe innere Sicherheit bietet. Sie macht Menschsein erst ertragbar. Man sollte sie deshalb nicht ausgrenzen.