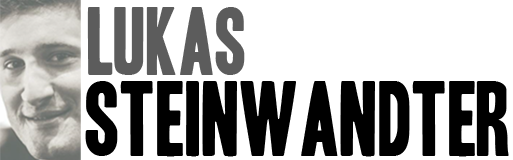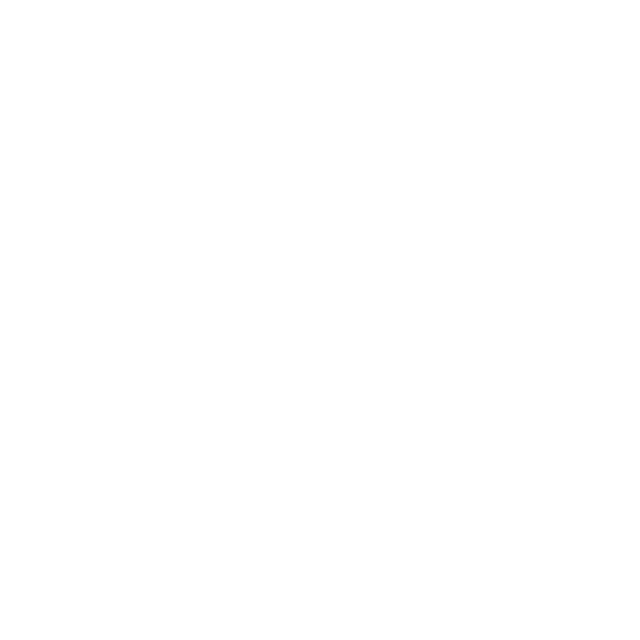In den Jahren 1800 und 1801 vollzog sich in den Vereinigten Staaten der erste reguläre Regierungswechsel in einer repräsentativen Demokratie. Das Zeitalter der Parteiendemokratie begann. Das ist lange her. Genauso lange kommt es meiner Generation vor, wenn man an die prämerkelsche Zeit denkt. Seitdem ich mich für Politik interessiere, ist die Pfarrerstochter Angela Merkel deutsche Kanzlerin. Und das wird wohl noch vier Jahre so sein.
Für das deutsche Politikwesen bedeutete diese Kontinuität einer Regierungsfigur, der man zuschreibt, sie habe eine „Lethargokratie“ begründet, eine trügerische Ruhe. Merkel wurde oft für ihre sachliche Politik gelobt. Sie begegne diesen stürmischen Zeiten (Terror, Digitalisierung, Globalisierung, internationale Konflikte) mit kühlem Kopf.
Unter anderem wegen dieser Wahrnehmung wählte eine Mehrheit der Deutschen sie wieder. Doch einen kühlen Kopf bewahrte Merkel in hitzigen Momenten selten. Zwar wirkte sie nach außen hin bedachtsam, nach innen schwenkte sie ihr Fähnlein allerdings immer im so, wie es gerade paßte. Ob im strahlengeladenen Wind aus Fukushima, in der tosenden Flüchtlingswelle und der Angst vor „schlimmen Bildern“ aus dem Mittelmeer, im Ehe-für-alle-Wahn oder im Gebell grüner Weltenretter vor dem Verbrennungsmotor: Stets konnte sie ihre politischen Gegner durch das Aufgeben ihrer Positionen vereinnahmen und unschädlich machen.
"We love Volkstod" – Linkradikale demonstrieren vor #AfD-Wahlparty. #BTW17 pic.twitter.com/e9tAWzKdVe
— Lukas Steinwandter (@LSteinwandter) September 24, 2017
Nun ist eine neue Partei in den Bundestag eingezogen, deren Positionen Merkel nicht annehmen wird. Ich war gestern abend auf der Wahlparty der AfD. Die Stimmung war getragen von Optimismus und Veränderungswillen. Draußen tobte ein Mob, der den AfDlern wahlweise mit dem Tod, der Ausbürgerung oder „Refugees“ drohte. Die Demonstranten schrien aus voller Kehle. Es flogen Bierflaschen in Richtung Wahlparty. Schließlich wurde zuerst die Terrasse von Sicherheitsmännern geräumt und dann die Feier von der Polizei aufgelöst – aus Sicherheitsgründen.
Wer glaubt, mit dem Einzug der AfD in den Bundestag werde sich die Debattenkultur in Deutschland – vor allem im Umgang mit rechten Organisationen – ändern, der irrt. Das beweisen auch die Reaktionen von Politikern, Journalisten und Vertretern der „Zivilgesellschaft“. Katrin Göring-Eckardt, die Spitzenkandidatin der Grünen, sagte über den AfD-Erfolg: „Es werden wieder Nazis im Bundestag sitzen. Für uns gilt: Wir werden keinen einzigen Angriff auf die Demokratie stehenlassen.“
Vom Pfarrer bis zum Radiomoderator: Alle rufen dazu auf, nicht #AfD zu wählen. Dieser Overkill in allen Kanälen geht nach hinten los. #BTW17
— Lukas Steinwandter (@LSteinwandter) September 24, 2017
Und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, fürchtete gar um das friedliche Leben in Deutschland: „Das Maß der Unterstützung für eine junge rechtspopulistische Partei ist ein Weckruf für alle, denen das friedliche und solidarische Miteinander in einem weltoffenen Deutschland am Herzen liegt.“ Ausgrenzende und haßerfüllte Stimmen dürften nicht das Leben in Deutschland vergiften. Die Liste ließe sich noch einige Seiten fortsetzen.
Sie haben also nichts gelernt. Sie wollen sich nicht sachlich und mithin ernsthaft damit beschäftigen, warum fast 13 Prozent der Wähler eine Partei gewählt haben, die im Frühjahr 2015 in der Versenkung zu verschwinden drohte. In Italien, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Tschechien, der Slowakei usf. existiert diese Kultur der Ausgrenzung von rechts nicht. Auch in Zukunft müssen sich Bürger, die der AfD nahestehen, zweimal überlegen, ob sie sich am Arbeitsplatz als „Blaue“ outen.
Linksradikale werfen Bierflaschen in Richtung der #AfD-Wahlparty #BTW17 pic.twitter.com/cCzJrdAIg0
— Lukas Steinwandter (@LSteinwandter) September 24, 2017
In Deutschland herrscht eine Form autoritärer Demokratie: Meinungspluralismus schön und gut, aber eine bestimmte Grenze nach rechts darf nicht überschritten werden. Dieses narkotisierende Gift eines Teils des offenbar vorhandenen Meinungsspektrums in Deutschland könnte die Demokratie auf Dauer zersetzen.
Der Druck im Kessel Deutschland steigt seit Jahren an. Mit der Bundestagswahl wurde ein Ventil geöffnet. Politiker, Wissenschaftler und Medienleute aus der vielzitierten Mitte täten gut daran, es nicht wieder zu schließen.